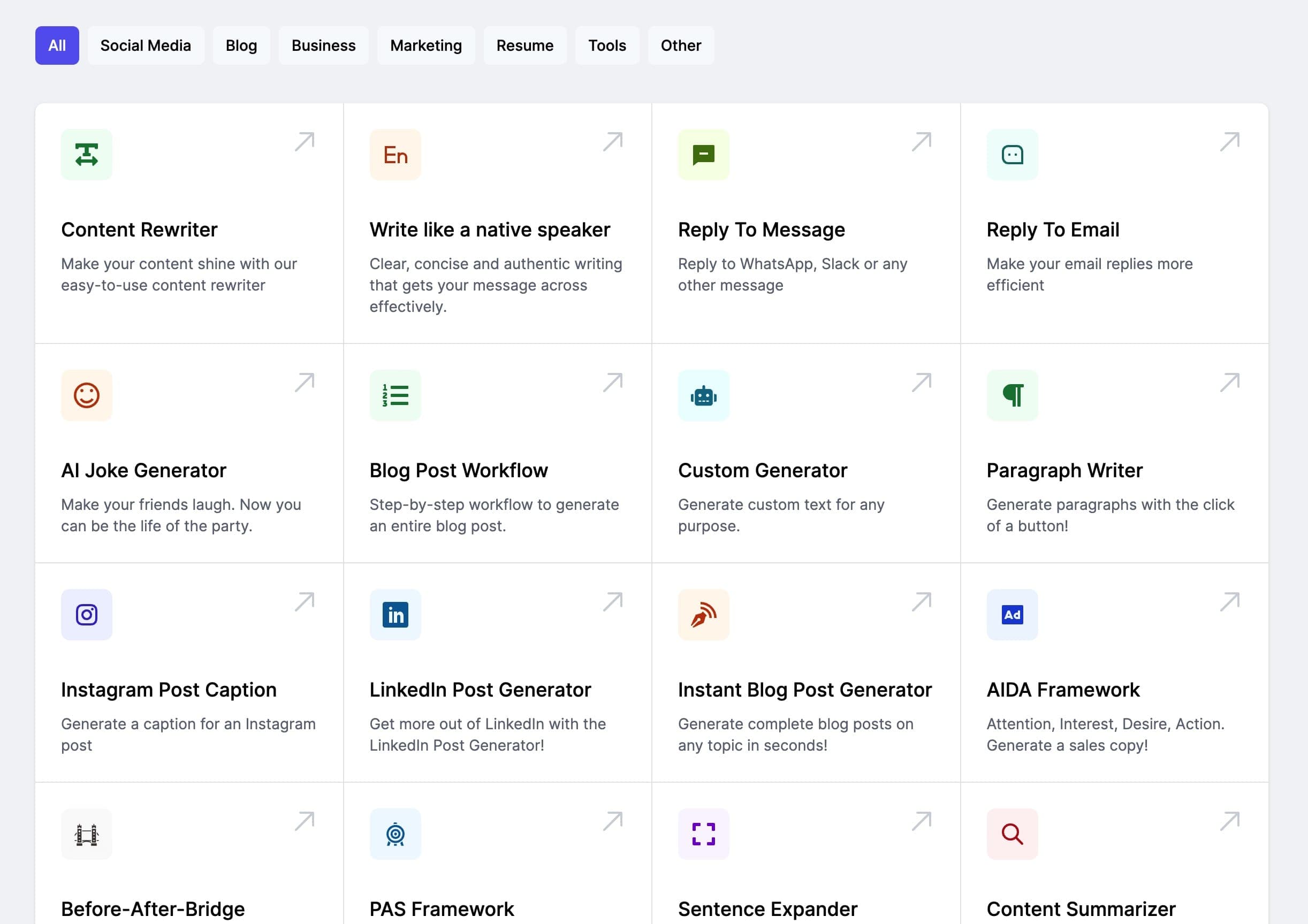II. Ablauf der klinischen Prüfung – Ausführliche Darstellung
Die klinische Prüfung unterliegt strengen rechtlichen Vorgaben, die im Arzneimittelgesetz (AMG) verankert sind. Gemäß § 40 AMG darf eine klinische Prüfung nur in geeigneten Prüfstellen und durch qualifizierte Prüfer durchgeführt werden. Als Prüfer kommt in der Regel ein verantwortlicher Arzt in Betracht, der für die Durchführung der klinischen Prüfung bei Menschen in einer Prüfstelle verantwortlich ist. In begründeten Ausnahmefällen kann diese Rolle auch von einer anderen Person übernommen werden, deren Beruf aufgrund seiner wissenschaftlichen Anforderungen und der notwendigen Erfahrung in der Patientenbetreuung für die Durchführung von Forschungen am Menschen qualifiziert ist (§ 4 Abs. 25 S. 1 AMG). Die Bewertung der Eignung der Prüfstelle und der Qualifikation der Prüfer obliegt dabei originär der zuständigen Ethik-Kommission (Bergmann, Gesamtes Medizinrecht, AMG, § 40 Rn. 5).
Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 AMG darf der Sponsor die klinische Prüfung erst aufnehmen, wenn zwei unabhängige Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muss die zuständige Ethik-Kommission die Prüfung positiv bewertet haben, zum anderen muss die zuständige Bundesoberbehörde die Prüfung genehmigt haben. Diese kumulative Voraussetzung stellt sicher, dass sowohl ethische als auch regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Der Sponsor als verantwortliche natürliche oder juristische Person übernimmt die Verantwortung für die Veranlassung, Organisation und Finanzierung der klinischen Prüfung (§ 4 XXIV AMG). Dabei kann es sich um ein Pharmaunternehmen handeln, das die Zulassung für ein Arzneimittel anstrebt, aber auch um einzelne Ärzte oder Hochschulen, die eine klinische Prüfung durchführen möchten (Maaßen, Die Versicherung klinischer Arzneimittel- und Medizinprodukteprüfungen, S. 7; Heil/Lützeler in: Dieners/Reese, Handbuch des Pharmarechts, § 4 Rn 131).
Die klinische Prüfung von Arzneimitteln wird international in vier Phasen unterteilt, wobei jede Phase eine eigenständige klinische Prüfung darstellt. Phase-I-Studien dienen der erstmaligen Erprobung eines Arzneimittels am Menschen und werden typischerweise an einer kleinen Gruppe von 10 bis 50 gesunden Probanden durchgeführt, um Daten zur Verträglichkeit, Pharmakokinetik und geeigneten Dosierung zu gewinnen (Maaßen, Die Versicherung klinischer Arzneimittel- und Medizinprodukteprüfungen, S. 8; Heil/Lützeler in: Dieners/Reese, Handbuch des Pharmarechts, § 4 Rn. 101f.). In besonderen Fällen, etwa bei Krebsmedikamenten mit potenziell schweren Nebenwirkungen, können Phase-I-Studien jedoch auch direkt an Patienten durchgeführt werden (Maaßen, a.a.O., S. 8; Stock, Der Probandenschutz bei der medizinischen Forschung am Menschen, S. 30).
Phase-II-Studien untersuchen die Wirksamkeit des Arzneimittels an etwa 100 bis 500 Patienten mit der Zielerkrankung. Hier kommen häufig randomisierte und verblindete Studiendesigns zum Einsatz, um objektive Ergebnisse zu gewährleisten (Maaßen, a.a.O., S. 8f.; Achtmann, Der Schutz des Probanden bei der klinischen Arzneimittelprüfung, S. 26f.). Phase-III-Studien schließlich umfassen mehrere tausend Patienten und dienen dem abschließenden Nachweis von Wirksamkeit und Sicherheit vor der Zulassung (Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn. 1307). Nach der Zulassung folgen Phase-IV-Studien, die der Langzeitbeobachtung von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen dienen (§ 63d AMG; Maaßen, a.a.O., S. 9f.).
Besondere Bedeutung kommt der Aufklärung und Einwilligung der Probanden zu. § 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 AMG betont die Notwendigkeit der freiwilligen Einwilligung nach umfassender Aufklärung. Die Aufklärung muss sich auf Wesen, Bedeutung, Risiken und Tragweite der klinischen Prüfung erstrecken und das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Teilnahme klar benennen (Bergmann, Gesamtes Medizinrecht, AMG, § 40 Rn. 9; BGH NJW 2006, 2477). Bei Minderjährigen oder nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen gelten besondere Schutzvorschriften (§§ 40 Abs. 4, 41 AMG).
Die Probandenversicherung stellt einen weiteren zentralen Aspekt dar. Der Sponsor ist verpflichtet, für einen ausreichenden Versicherungsschutz der Studienteilnehmer zu sorgen. Fehler in der Aufklärung über den Versicherungsumfang können zu Haftungsansprüchen führen, wenn der Proband nachweist, dass er bei korrekter Information nicht in die Studienteilnahme eingewilligt hätte (Achtmann, Der Schutz des Probanden bei der klinischen Arzneimittelprüfung, S. 273 ff.).